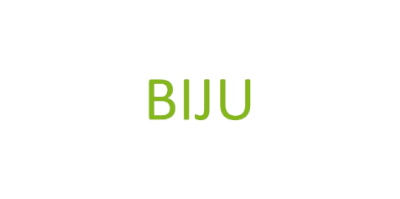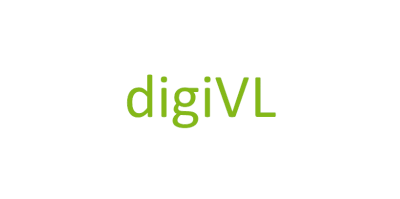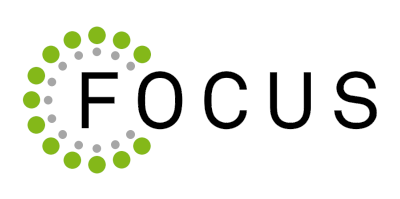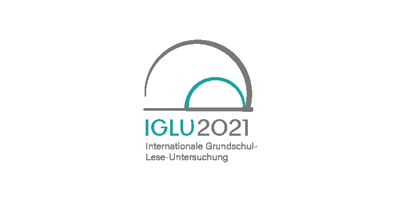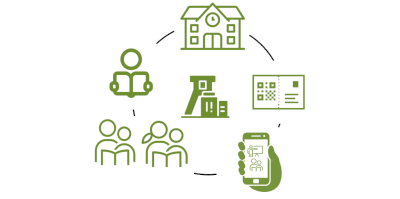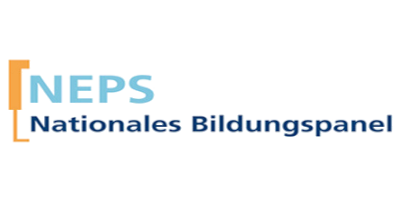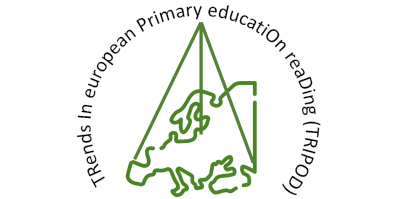Forschung am IFS
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des IFS forschen in interdisziplinär zusammengesetzten Teams zu den genannten Themen der empirischen Schulentwicklungs- und Bildungsforschung, wobei insbesondere erziehungswissenschaftliche, psychologische und soziologische Theorien diskutiert, weiterentwickelt und empirisch überprüft werden. In Abhängigkeit vom jeweiligen Forschungsprojekt kommen dabei eine Vielzahl von Forschungsdesigns (z.B. Längsschnitt, Large-Scale, Experiment, Intervention), Erhebungsmethoden (u.a. Fragebögen, Interviews, Kompetenztests, Videographie) und quantitativen und qualitativen Auswertungsmethoden zum Einsatz.

Das IFS beteiligt sich aktiv durch Publikationen, Vorträge und Konferenzbeteiligungen sowie durch interdisziplinäre Verbundforschungsprojekte am nationalen und internationalen fachwissenschaftlichen Austausch. Zudem pflegt das IFS enge Kontakte zu Schulen und weiteren Strukturen der Bildungsadministration. Diese Praxisnähe mit dem damit verbundenen Wissenstransfer und der nationale und internationale fachwissenschaftliche Austausch machen in ihrer Kombination eine besondere Stärke des Instituts aus.
Forschungsbericht
In regelmäßigen Abständen veröffentlicht das IFS seine Aktivitäten in einem Forschungsbericht und stellt diesen zum Download als PDF bereit: Forschungsbericht 2022-2023.
Aktuell laufende Forschungsprojekte am IFS
Aktuelles aus der Forschung
Artikel in Behavior Research Methods erschienen
- Publikationen
- News
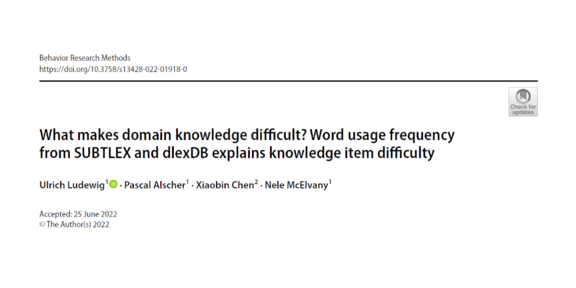
Ludewig, U., Alscher, P., Chen, X. & McElvany, N. (2022). What makes domain knowledge difficult? Word usage frequency from SUBTLEX and dlexDB explains knowledge item difficulty. Behavior Research Methods. doi.org/10.3758/s13428-022-01918-0
Der Artikel befasst sich mit dem Zusammenhang von Worthäufigkeit und der Schwierigkeit von Aufgaben in Wissenstests, denn die Qualität von Tests mit psychologischen und bildungswissenschaftlichen Anwendungen ist von großem wissenschaftlichem und öffentlichem Interesse. Aufgabenschwierigkeitsmodelle sind für eine evidenzbasierte Interpretation von Testergebnissen unerlässlich. Ein wesentlicher Faktor für die Schwierigkeit von Aufgaben in Wissenstests ist die Häufigkeit und Art von Gelegenheiten etwas über die fraglichen Fakten und Konzepte zu lernen. Wissen wiederum wird hauptsächlich durch Sprache vermittelt. Die Verwendung von Sprache im Zusammenhang mit Fakten und Konzepten könnte ein Indikator für Lerngelegenheiten sein. Die Wissenschaftler*innen stellen die Hypothese auf, dass die Aufgabenschwierigkeit in Wissenstests damit zusammenhängt wie häufig die Wörter in den Aufgaben im Alltags und/oder im akademische Kontext verwendet werden. Die Ergebnisse einer Studie mit 99 Items aus politischen Wissenstests, die N = 250 deutschen Siebt- (Alter: 11-14 Jahre) und Zehntklässlern (Alter: 15-18 Jahre) vorgelegt wurden, zeigen, dass Worthäufigkeit im Alltag (SUBTLEX-DE) die Varianz in der Itemschwierigkeit erklären, während Worthäufigkeiten im akademischen Kontexten (dlexDB) allein dies nicht tun. Beide Arten der Worthäufigkeit zusammen erklären jedoch einen beträchtlichen Teil der Varianz in der Schwierigkeit der Items. Aufgaben mit Wörtern, die in beiden Kontexten häufiger vorkommen und insbesondere in alltäglichen Kontext relativ häufig vorkommen, sind leichter. Absolut hohe Worthäufigkeiten und relativ hohe Worthäufigkeiten in alltäglichen Kontext stehen möglicherweise in Zusammenhang mit einer höheren Wahrscheinlichkeit von Lerngelegenheiten, aber auch der konzeptionellen Komplexität und der Lesbarkeit der Aufgabeninhalte. Die Untersuchung der Worthäufigkeit in verschiedenen Sprachkontexten kann Forscher*innen helfen, die Interpretation der Testergebnisse zu untersuchen, und ist ein nützliches Instrument zur Vorhersage von Aufgabenschwierigkeit und zur Verbesserung von Wissenstestaufgaben.