1. Reihe Tuesdays for Education: „Was zeigen uns Ergebnisse aus IGLU 2021 für die Weiterentwicklung des Schulsystems in Deutschland?“
11.06.2024 – Bedeutung des sozio-ökonomischen Hintergrunds der Schülerfamilien und der Übergang auf die weiterführende Schule

Der Übergang von der Grundschule auf die weiterführende Schule stellt die Weichen für die weiteren Bildungskarrieren. Um Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit zu gewährleisten, sollte der soziale Hintergrund für eine Gymnasialempfehlung keine Rolle spielen. Die Sonderauswertung der IGLU 2021 Studie zeigt jedoch, dass Kinder aus sozioökonomisch benachteiligten Familien nur etwa halb so häufig eine Gymnasialempfehlung erhalten wie Kinder aus sozioökonomisch privilegierten Familien. Auch bei gleichen Leistungen ist die Wahrscheinlichkeit noch deutlich niedriger. Die Wahrscheinlichkeit einer Gymnasialempfehlung steigt überdies für Kinder beider Gruppen, wenn sie eine Klasse mit im Mittel höherem sozioökonomischen Status besuchen.
Zu Gast: Dr. Birgit Heppt, Humboldt-Universität zu Berlin und Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen
Weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung und im Kurzbericht.
14.05.2024 – Zuwanderung und Familiensprache

Für eine erfolgreiche Schullaufbahn, Chancengleichheit und gesellschaftliche Teilhabe sind Basiskompetenzen wie Lesen von größter Bedeutung. Die Sonderauswertung der Internationalen Grundschul-Lese-Untersuchung 2021 (IGLU) zeigt, dass für jedes vierte Grundschulkind Deutsch nicht die Muttersprache ist. Kinder, die erst in der Schule Deutsch gelernt haben, weisen besonders hohe Kompetenzrückstände auf. Auch die Verteilung der Zuwanderungszeitpunkte weist auf den Bedarf an unterschiedlichen Sprachförderkonzepten hin. Im Deutschunterricht von fast der Hälfte der Grundschüler*innen werden Kinder mit Deutsch als Zweit- oder Fremdsprache nie oder nur selten gezielt gefördert. Die heterogene Schülerschaft benötigt unterschiedliche Förderangebote, die jedoch häufig noch nicht ausreichend bestehen.
Zu Gast: Prof. Dr. Aileen Edele, Humboldt-Universität zu Berlin, Lehrstuhl für Empirische Lehr-Lernforschung unter Bedingungen migrationsbezogener Heterogenität
Weitere Informationen finden Sie in der Pressemeldung und im Kurzbericht.
09.04.2024 – Wohlbefinden von Schülerinnen und Schülern in Deutschland und im internationalen Vergleich

Das Wohlbefinden von Kindern ist im Kontext Schule unter anderem dann gefährdet, wenn sie in ihrer Klasse oder Schule mit dissozialem Verhalten – problematischen Verhaltensweisen anderer Kinder – konfrontiert sind. Anhand der Befragung der Schüler*innen im Rahmen von IGLU 2021 zeigt sich, dass fast die Hälfte der Grundschulkinder Erfahrungen mit physischer Gewalt und über 10 Prozent mit Online-Mobbing gemacht haben. Insgesamt sind die Erfahrungen der Grundschulkinder mit dissozialen Verhaltensweisen ähnlich wie im EU-Durchschnitt ausgeprägt. In Deutschland ist der Unterschied in der Lesekompetenz zwischen Kindern mit viel und Kindern mit wenig Erfahrungen mit dissozialem Verhalten im EU-Vergleich jedoch am größten.
In Anbetracht dieser Erkenntnisse sollte die Verringerung von dissozialem Verhalten in Grundschulen ein Fokus von Bildungspolitik und -praxis in Deutschland sein. Initiativen wie Tuesdays for Education tragen dazu bei, das Bewusstsein für die Bedeutung eines positiven Schulumfelds zu schärfen und Strategien zur Förderung des Wohlbefindens und zur Prävention von dissozialem Verhalten zu entwickeln. „Langfristig können solche Maßnahmen nicht nur das akute Wohlbefinden von Schüler*innen verbessern, sondern auch zu einer positiveren Entwicklung von schulischen Leistungen wie der Lesekompetenz beitragen“, konstatiert die Studienleiterin Professorin Nele McElvany.
Zu Gast: Dr. Justine Stang-Rabrig, IFS TU Dortmund
Weitere Informationen finden Sie in der Pressemeldung und im Kurzbericht.
12.03.2024 – Schulische Ressourcen und Prioritäten

Die bei IGLU 2021 befragten Schulleitungen in Deutschland schätzen die schulischen Ressourcen insgesamt eher gut ein, dies jedoch in Abhängigkeit der wirtschaftlichen Lage der Schülerschaft. Größerer Mangel als im EU-Durchschnitt wird unter anderem bei Bibliotheksausstattung und im Bereich Technik und Medien gesehen. Grundschulen in Deutschland, an denen mehr als ein Viertel der Schüler*innen aus wirtschaftlich benachteiligten Familien stammt, sind in höherem Maße von Knappheit schulischer Ressourcen betroffen als Schulen mit einem Anteil bis zu 25 Prozent. Besonders groß ist der Unterschied bei der Ausstattung mit Material (z.B. Papier, Stifte), Technik und Medien zur Unterstützung des Lernens und Unterrichtsräumen (z. B. Klassenzimmer). Die Schulleitungen schätzen die Erwartungen der Lehrkräfte hinsichtlich der Leistungen der Schüler*innen etwas geringer ein als ihre Kolleg*innen im EU-Durchschnitt.
Zu Gast: Prof. Dr. Susanne Lin-Klitzing, Bundesvorsitzende des Deutschen Philologenverbandes
Weitere Informationen finden Sie in der Pressemeldung und im Kurzbericht.
13.02.2024 – Geschlechtervergleich: Lesekompetenz, Motivation, Selbstkonzept

Die Entwicklung der Lesekompetenz hängt von einer Reihe von Faktoren ab, die das Institut für Schulentwicklungsforschung im Rahmen der Tuesdays for Education auf Basis der repräsentativen IGLU-Daten in den Blick nimmt. Wie groß ist der Geschlechterunterschied bei der Lesekompetenz in Deutschland und im internationalen Vergleich? Was hat sich in den vergangenen 20 Jahren verändert? Gibt es geschlechterspezifische Unterschiede in der Lesemotivation und bei dem Leseselbstkonzept? Wie motivierend nehmen Grundschulkinder den Leseunterricht wahr?
Mädchen erreichen durchschnittlich eine signifikant höhere Punktzahl in der Lesekompetenz als Jungen. Mit einem Vorsprung der Mädchen von 15 Punkten liegt Deutschland im internationalen Vergleich im Mittelfeld. Während in einigen Ländern der geschlechterspezifische Lesekompetenzunterschied zurückgegangen ist, zeigt sich für Deutschland im 20-Jahre-Trend keine signifikante Veränderung. Mädchen haben eine höhere Lesemotivation und ein besseres Leseselbstkonzept. Im Gegensatz zu Jungen nehmen sie den Leseunterricht motivierender wahr. Ein motivierender und differenzierter Leseunterricht hat das Potenzial die Lesemotivation bei Jungen zu erhöhen.
Zu Gast: Prof. Dr. Ilka Wolter, Universität Bamberg, Lehrstuhl für Bildungsforschung mit dem Schwerpunkt Entwicklung und Lernen
Weitere Informationen finden Sie in der Pressemeldung und im Kurzbericht.
09.01.2024 – Unterricht und Lesezeit

Die Entwicklung der Lesekompetenz hängt von einer Reihe von Faktoren ab, die das Institut für Schulentwicklungsforschung im Rahmen der Tuesdays for Education auf Basis der repräsentativen IGLU-Daten in den Blick nimmt. Wie ist die Unterrichtsqualität des Leseunterrichts an Grundschulen in Deutschland? Wie verhält sich die Lesezeit in Deutschland im internationalen Vergleich? Wie erfolgt die Diagnostik der Lesekompetenz und welche Lesestrategien werden angewendet?
Grundschulkinder attestieren ihren Lehrkräften keine ausreichend effiziente Klassenführung, fühlen sich aber in hohem Maße kognitiv aktiviert und nehmen ihre Lehrkräfte als unterstützend wahr. Weiterhin wird systematischen Diagnostikverfahren bei der Kompetenzermittlung im Durchschnitt eine eher geringe Bedeutung beigemessen und es werden in Deutschland im Vergleich zu anderen EU-Staaten seltener Lesestrategien eingesetzt, die das Verständnis vertiefen.
„Insgesamt zeigt sich für Deutschland ein erhebliches Verbesserungspotential in den untersuchten Bereichen. Von besonderer Bedeutung ist eine systematische Diagnostik der Lesekompetenz, denn nur so können Lesekompetenzstände verlässlich erfasst und eine gezielte Förderung, sei es in Kleingruppen oder individuell, und auch unter Nutzung von Lesestrategien auf den Weg gebracht werden“, resümiert die Studienleiterin Professorin Nele McElvany.
Zu Gast: Prof. Dr. Steffen Gailberger, Bergischen Universität Wuppertal, Lehrstuhl für Didaktik der deutschen Sprache und Literatur
Weitere Informationen finden Sie in der Pressemeldung und im Kurzbericht.
12.12.2023 – Wie vorbereitet kommen Kinder in die Schule?

Lernen in der Grundschule baut auf vorhandene Fähigkeiten der Kinder auf. Vor diesem Hintergrund geht das Institut für Schulentwicklungsforschung (IFS) der Frage nach, wie gut vorbereitet Kinder in die Schule starten. Aktuellen IGLU-Analysen zufolge ist ein Großteil der Kinder in Deutschland bei Schuleintritt schlecht vorbereitet. So berichten 78 Prozent der Schulleitungen, dass weniger als jedes vierte Kind bei Schuleintritt über grundlegende Lese- und Schreibkompetenzen verfügt. Bei allen teilnehmenden EU-Staaten sind dies nur 41 Prozent. Auch die Eltern kommen zu einer ähnlichen Einschätzung. Gerademal 9 Prozent der Kinder in Deutschland verfügen laut Elternangaben bei Schuleintritt über „sehr gute“ lesebezogene Fähigkeiten – dies ist der niedrigste Anteil im Vergleich mit allen teilnehmenden EU-Staaten. Der Anteil mit „nicht guten“ Fähigkeiten liegt in Deutschland bei 67 Prozent. Nur 15 Prozent können beispielsweise einige Wörter sehr gut lesen (in der EU: 28 %) und nur 20 Prozent Buchstaben des Alphabets sehr gut schreiben (in der EU: 35 %).
Zu Gast: Prof. Dr. Yvonne Anders, Universität Bamberg, Lehrstuhl für Frühkindliche Bildung und Erziehung
Weitere Informationen finden Sie in der Pressemeldung und im Kurzbericht.
14.11.2023 – Wie werden digitale Medien im Unterricht eingesetzt?

Digital vermittelte Informationen lesen und verarbeiten zu können, gilt als zunehmend unverzichtbar für den privaten, schulischen und beruflichen Alltag wie auch für gesellschaftliche Teilhabe und lebenslanges Lernen. Vor diesem Hintergrund geht das Institut für Schulentwicklungsforschung (IFS) der Frage nach, wie digitale Medien im Grundschulunterricht eingesetzt werden, und stellte fest, dass die Nutzungshäufigkeit in Deutschland im internationalen Vergleich – auch differenziert nach verschiedenen Leseaktivitäten – noch gering ist. Die Nutzungsdauer digitaler Medien zum Suchen und Lesen von Informationen unterscheidet sich zwischen Jungen und Mädchen erheblich. Signifikant mehr Jungen lesen länger als 30 Minuten pro Tag oder gar nicht, während in der Kategorie der bis zu 30 Minuten Nutzenden signifikant mehr Mädchen sind. Aktuelle IGLU-Analysen zum Lesen in Online-Umgebungen (ePIRLS) zeigen jedoch auch, dass die Schülerinnen und Schüler überwiegend gut in einer Umgebung, die wie das Internet aussieht, lesen, interpretieren und Inhalte kritisch reflektieren können.
Zu Gast: Prof. Dr. Thomas Irion, Direktor des Zentrums für Medienbildung (Abteilung: Erziehungswissenschaft / Grundschulpädagogik)
Weitere Informationen finden Sie in der Pressemeldung und im Kurzbericht.
10.10.2023 – Was können wir für das deutsche Bildungssystem von anderen Ländern lernen?

Lesen ist eine Basiskompetenz und stellt eine grundlegende Voraussetzung für das Lernen in allen weiteren Fächern dar. Deutschland hat die erhofften bildungspolitischen Ziele nicht erreicht, stellt die geschäftsführende Direktorin des IFS, Professorin Nele McElvany, fest: „Die Entwicklung der Lesekompetenz in Deutschland von 2001 bis 2021 ist mit einem signifikanten Rückgang der mittleren Lesekompetenz und einem signifikanten Anstieg des Abstands zwischen den stärksten und schwächsten Lesenden als problematisch einzuordnen“. Was kann das deutsche Bildungssystem von anderen Ländern lernen? Dieser Frage geht die Programmreihe Tuesdays for Education des IFS am zweiten Termin nach.
Im Gegensatz zu Deutschland ist es einigen Staaten gelungen, die mittlere Lesekompetenz zu erhöhen oder hoch zu halten und gleichzeitig die Leistungsstreuung zu reduzieren oder gering zu halten. Welche Maßnahmen erscheinen dazu hilfreich? „Viele der erfolgreichen Länder zeichnen sich dadurch aus, dass sie flächendeckende oder verpflichtende Screenings zu Beginn der Grundschule und/oder kontinuierliche Förderdiagnostik einsetzen, wie beispielsweise in England, Dänemark oder den Niederlanden“, konstatiert Dr. Ulrich Ludewig. „Die Lesekompetenzentwicklung der Schüler*innen wird in Deutschland im Unterricht hingegen kaum systematisch geprüft, für die Ermittlung des Lesekompetenzstandes greifen die Lehrkräfte überwiegend auf informelle Diagnostikverfahren zurück.“ Die Schulen in Singapur testen beispielsweise zu Beginn der ersten Klasse die Lese- und Rechenfähigkeiten der Schüler*innen. Diejenigen, die zusätzliche Hilfe benötigen, werden in kleinen Lernförderprogrammen unterrichtet, damit sie mit ihren Altersgenoss*innen mithalten können. Ähnlich verhält es sich in Finnland, die Lehrkräfte verweisen die Schüler*innen an spezialisierte Vollzeitkräfte, die je nach Bedarf mit den Schüler*innen in Kleingruppen oder auch einzeln arbeiten. In Deutschland gibt es nur wenige Angebote über den gemeinsamen Unterricht im Klassenverband hinaus. Zudem muss die Vorschule stärker in den Blick genommen werden: Viele der Staaten und Regionen, z.B. die Tschechische Republik oder Polen, mit einer hohen Lesekompetenz setzen auf eine strukturierte Vorschule mit Lernzielen in Form von eigenen vorschulischen Curricula.
Zu Gast: PD Dr. Rolf Strietholt, IFS TU Dortmund
Weitere Informationen finden Sie in der Pressemeldung und im Kurzbericht.
12.09.2023 – Fokus Lehrkräfte: Ausbildung, Fortbildung, Berufszufriedenheit, Belastungserleben
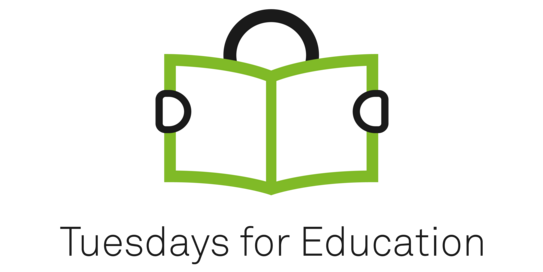
Vor dem Hintergrund akuter Herausforderungen wie den lediglich durchschnittlichen Ergebnissen bei internationalen Vergleichsstudien, der schleppenden Digitalisierung von Schulen in Deutschland sowie dem Lehrkräftemangel setzt das IFS im Kontext der Befunde der IGLU-Studie mit den „Tuesdays for Education“ eine neue Programmreihe auf, in der aktuelle Befunde zu Themen rund um den Weiterentwicklungsbedarf von Grundschulen vorgestellt und diskutiert werden. Ab dem 12. September 2023 widmet sich die Programmreihe jeden Monat am zweiten Dienstag insbesondere der Weiterentwicklung der Grundschule in Deutschland. Dabei wird ein besonderer Fokus auf die Schlüsselkompetenz „Lesen“ gelegt, da diese Kompetenz von entscheidender Bedeutung für die gesamte schulische und berufliche Laufbahn und den privaten Lebensweg der Kinder ist. Mit der Reihe „Tuesdays for Education“ sollen die großen Themen im Bildungsbereich vorangetrieben, neue Ideen gefördert und Einblicke in die aktuellen Forschungsergebnisse gegeben werden. Daher erscheint zukünftig am zweiten Dienstag im Monat ein Kurzbericht zu einem zentralen Thema mit begleitender Pressemitteilung. Interessierte sind eingeladen, an einem kostenfreien Webinar teilzunehmen, in den Dialog zu treten und mitzudiskutieren.
Die erste Sitzung am 12. September („Fokus Lehrkräfte: Ausbildung, Fortbildung, Berufszufriedenheit, Belastungserleben“) wird sich thematisch damit beschäftigen, wie zufrieden die Grundschullehrkräfte mit ihrem Beruf sind und wo sie Verbesserungsbedarfe in der Aus- und Fortbildung sehen.
Zu Gast: Prof. Dr. Anita Schilcher, Universität Regensburg, Lehrstuhl für Didaktik der deutschen Sprache und Literatur
Weitere Informationen finden Sie im Kurzbericht.






